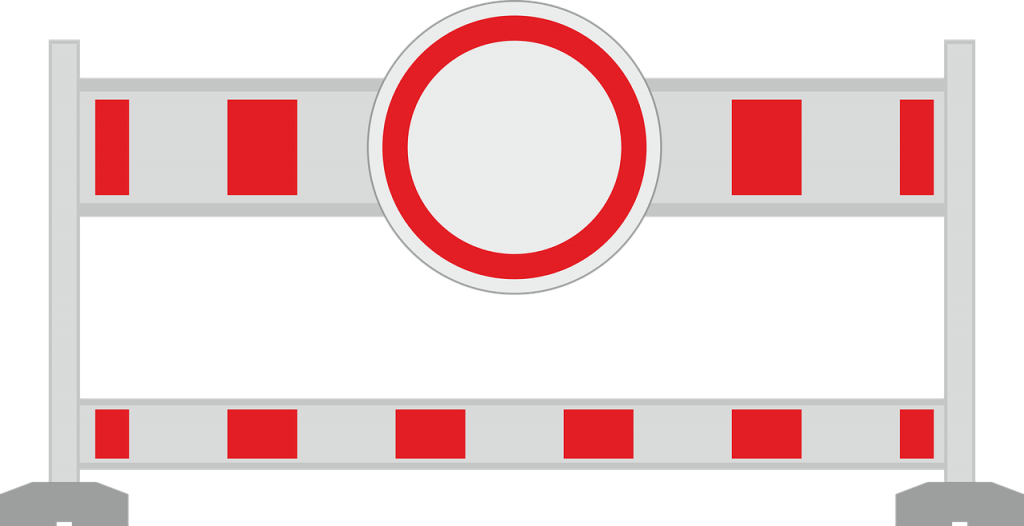
Die Europawahl 2019 ist vorbei und wieder einmal wird die Einführung einer Sperrklausel für die nächste Europawahl gefordert. Diese würde künftig kleine Parteien aus dem Europaparlament ausschließen. Das ist für mich ein Grund über die Sperrklausel, besonders für die Wahlen zum Bundestag und für Landtagswahlen, nachzudenken.
Ein Blick ins Grundgesetz
Die gute Nachricht ist: Über eine Sperrklausel steht nichts im Grundgesetz. Der Artikel 38 sagt für die Wahl zum Bundestag folgendes aus:
(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.
Somit ist für Änderungen im Bundeswahlgesetz, welches die Sperrklausel in § 6 Abs. 3 enthält, nicht einmal eine Grundgesetz-Änderung notwendig. Für Landtagswahlen und Kommunalwahlen gelten Wahlgesetze mit oder ohne Sperrklausel.
Wahlen und Parteien
Die Aussage die das Grundgesetz zu den Parteien trifft, erscheint mir wichtig. Schließlich reden wir hier von den Parteien die Wahlkämpfe führen, als Regierungs- oder Oppositionsparteien agieren, die Koalitionen und Fraktionsgemeinschaften bilden – also von denen die das politische Leben dominieren. Dazu sagt das Grundgesetz im Artikel 21:
(1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.
Sie wirken mit – nicht „sie regieren das Land“, das tun sie erst, wenn sie gewählt sind.
Die Sperrklausel
Die Sperrklausel, bekannter als 5%-Hürde (BWG §6 Abs.3), wurde eingeführt um die Zersplitterung des Parlaments zu verhindern. Heute behindert sie neue Parteien mit anderen Organisationskonzepten, und nimmt WählerInnen-Stimmen ihr Gewicht. Bei der Bundestagswahl 2017 wurden durch die Sperrklausel 5% der abgegebenen gültigen Stimmen für die Sitzverteilung im Bundestag nicht berücksichtigt. Es ist ein Zufall, dass die Prozentzahl der nicht berücksichtigten Stimmen mit der 5%-Zahl der Sperrklausel übereinstimmt. Bei einem höheren oder niedrigeren Anteil der WählerInnen-Stimmen für Kleinparteien sieht das anders aus.
Wahlmathematik
5% der abgegebenen gültigen Stimmen, das klingt nach nicht viel. Betrachten wir aber das Ergebnis bei den Zweitstimmen (für die gilt ja die Sperrklausel), dann sieht das anders aus.
2017 haben 75,2% der wahlberechtigten BürgerInnen ihre Stimme abgegeben.
Das sind in Zahlen 46.973.799 Stimmen, davon waren 46.506.857 gültige Zweitstimmen, also geht es bei 5% um 2.325.343 WählerInnen deren Stimmen keinen Einfluss hatten.
Die Sperrklausel hatte sogar einen von den WählerInnen nicht gewollten Effekt. Die Anzahl und Verteilung der Sitze im Bundestag wird aus den gültigen Stimmen berechnet, nicht aus den Stimmen für die im Bundestag vertretenen Parteien. Im Klartext bedeutet das, dass unter Umständen z.B. die AfD von den Stimmen der MLPD-WählerInnen profitiert.
Argumente gegen die Sperrklausel
- Eine Nichtberücksichtigung von 2,3 Millionen Wählerstimmen ist, meines Erachtens nach, undemokratisch. Wie oben beschrieben könnten es ja auch mehr Stimmen sein, wenn der Stimmenanteil für Parteien die die Sperrklausel nicht überwinden ansteigt.
- Der wichtigere Punkt für mich ist: Die Sperrklausel hat in der Geschichte der Bundesrepublik dazu geführt, dass Themen so lange vernachlässigt werden bis eine Partei die diese aufnimmt und vertritt die 5%-Hürde überwindet.
Dazu möchte ich als Beispiel die Genese der Parteien „Die Grünen“ und AfD betrachten – die empfindlichen Seelen unter den LeserInnen scrollen bitte vor dem Lesen zum Disclaimer. Bei der Betrachtung ist mein Schwerpunkt darauf gelegt, dass die Entwicklung der Parteien hauptsächlich auf die „issue ownership“* – bei den Grünen für die Umweltpolitik und bei der AfD für das Migrationsthema** – zurückzuführen ist. Das erfolgreiche Agenda- Setting mit diesen Themen führte bei beiden Parteien zum Aufstieg.
Die Grünen
In den 1970ern bildete sich in Westdeutschland eine aktive Umweltbewegung heraus, die schlussendlich 1980 zur Gründung der Partei „Die Grünen“ führte. Nach der Niederlage 1980 bei der Bundestagswahl, dem Einzug 1983 mit 5,6 % der Zweitstimmen und der Steigerung bei der Wahl 1987 auf 8,3% war die Umweltpolitik im Parlament angekommen, wurde aber mit der ersten gesamtdeutschen Wahl 1990 wieder abgewählt. Die im Bundestag vertretenen Parteien konnten somit die Umweltpolitik weiter ignorieren. 1994 erfolgte der Wiedereinzug in den Bundestag und 1998 die erste Regierungsbeteiligung – erst jetzt nach rund 25 Jahren begannen die bis dato „großen Parteien“ also CDU/CSU, SPD und FDP sich für dieses Thema zu interessieren, zumindest verbal. Mit Beginn der „ewigen Regierung“ unter Kanzlerin Merkel trat das, über Absichtsbekundungen hinausgehende, Interesse an Umweltthemen bei dieser wieder in den Hintergrund. Es wurde erst wieder erweckt als nach „Fridays For Future“ und den rapide ansteigenden Beliebtheitswerten für „Die Grünen“ ein Rückgang der Wählerstimmen für CDU/CSU und SPD zu verzeichnen war.
Die AfD
Westdeutschland, also die Bundesrepublik vor der Vereinigung, war immer stolz darauf, dass es rechts von CDU/CSU und links von der SPD keine Parteien im Bundestag gab. Die Sperrklausel verhinderte das, außerdem betreuten besonders CDU/CSU das „reichsdeutsche“ Klientel wie die Vertriebenenverbände unter dem Label „Brauchtumspflege“. Alle hofften, dass mit den letzten Vertriebenen das Thema von selbst ausstirbt.
Rechte Parteien wie NPD, Republikaner usw. konnten mit der Sperrklausel erfolgreich aus dem Bundestag fern gehalten werden. Die einzige Ausnahme war die Wahlperiode 1953-1957, als der „Gesamtdeutsche Block“ die Sperrklausel überwand. Die WählerInnen-Stimmen für Revanchismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und sonstige rechte Tendenzen fielen somit nicht ins Gewicht und die Beschäftigung mit diesen Themen konnten die „großen Parteien“ ignorieren.
Hier ein Hinweis: Von 1957 bis 1983 war das „Biotop Bundestag“ drei Parteien, nämlich CDU/CSU, SPD und FDP, vorbehalten. Mit rechten Tendenzen in der Bevölkerung wollten diese sich nicht beschäftigen – der Feind stand im Osten und hieß Kommunismus.
Das klappte auch nach dem Einzug der Grünen und der PDS in den Bundestag, bis sich 2013 eine neue Partei gründete. Diese bezeichnete sich ursprünglich als Euro-kritisch, wurde aber bald zum Sammelbecken für alle rechten Tendenzen und knackte ab 2014 zuerst die Sperrklausel in Landesparlamenten und 2017 auch die für den Bundestag. Die in diesem Falle Jahrzehnte lange Verweigerung der parlamentarischen Auseinandersetzung mit den Rechten, die ohne Sperrklausel möglich und nötig gewesen wäre, ist einer der Gründe für den Erfolg dieser Partei.
Merke:
Themen werden für die im Parlament vertretenen Parteien erst interessant, wenn eine Partei, die die „issue ownership“* für dieses Thema besitzt, die 5%-Hürde überwunden hat. Das generelle Interesse der BürgerInnen spielt erst eine Rolle, wenn es durch eine Partei im Parlament vertreten wird – sind es mehrere kleine Parteien außerhalb des Parlamentes, dann wird das Thema weitgehend ignoriert.
Fazit:
Sowohl im Bundestag als auch in den Landesparlamenten hat die Sperrklausel dazu geführt, dass Tendenzen in der Bevölkerung so lange „übersehen“ werden, bis sich eine Partei findet die diese aufnimmt und WählerInnen-Stimmen von mehr als 5% generieren kann. Dann reagieren die in den Parlamenten vertretenen Parteien panisch und versuchen diese Themen aufzunehmen. Das hat nur mäßigen Erfolg, da die BürgerInnen dann oft lieber das Original wählen. Eine parlamentarische Auseinandersetzung mit kleinen Parteien – also mit wenigen Sitzen im Parlament – ist hier, meiner Meinung nach, der bessere Weg. Diese Auseinandersetzung verhindert, dass Themen ignoriert werden.
Der völlig falsche Weg ist es die Sperrklausel, wie von vielen Politikern gefordert, auch auf die Europawahl und sogar auf Kommunalwahlen auszuweiten.
Disclaimer:
Der Vergleich von „Die Grünen“ und AfD bezieht sich ausschließlich auf der Entwicklung der Parteien. Ein weiterer Vergleich wäre absurd. Ich will auch keine Rechten im Parlament – es ist aber die einzige Möglichkeit der Auseinandersetzung bevor es zu spät ist. In den Vergleichen habe ich „Die Linke“ nicht erwähnt, weil die Entstehungsgeschichte eine andere, nicht themenabhängige, ist. Die Piratenpartei, die ich selbst im Stadtrat Leipzig vertrete, habe ich ebenfalls nicht erwähnt. Ich habe mich auf die im Bundestag vertretenen Parteien konzentriert. Der Kampf gegen die Sperrklausel betrifft nicht nur die Piraten.
Anmerkungen:
*issue ownership: in der Politologie wird dieser Begriff oft gebraucht. Eine klare Definition dazu habe ich nicht gefunden, aber am besten trifft es wohl: „Der Besitz eines Themas als Problemlöser durch eine Partei oder eine/n PolitikerIn“. Elisabeth Günther, Emese Domahidi & Thorsten Quandt beschreiben es als: „Assoziation zwischen Partei und Thema – die Reputation einer Partei, in einem Themenbereich dominant zu sein, und die daraus abgeleitete, ihr zugeschriebene sachbezogene Kompetenz“ Ich verwende den Begriff, weil ich keinen kurzen und schlüssigen deutschen Begriff dafür gefunden habe.
** Das Migrationsthema ist natürlich nicht das einzige Thema der AfD. Auf diesem Thema beruht aber das Agenda-Setting der AfD. Monothematisch werden auch Sozialpolitik, Rentenpolitik und anderes immer wieder auf die „verfehlte Migrationspolitik“ der GroKo und besonders der Kanzlerin zurückgeführt.
Bildnachweis: unter CCO von succo auf Pixabay



