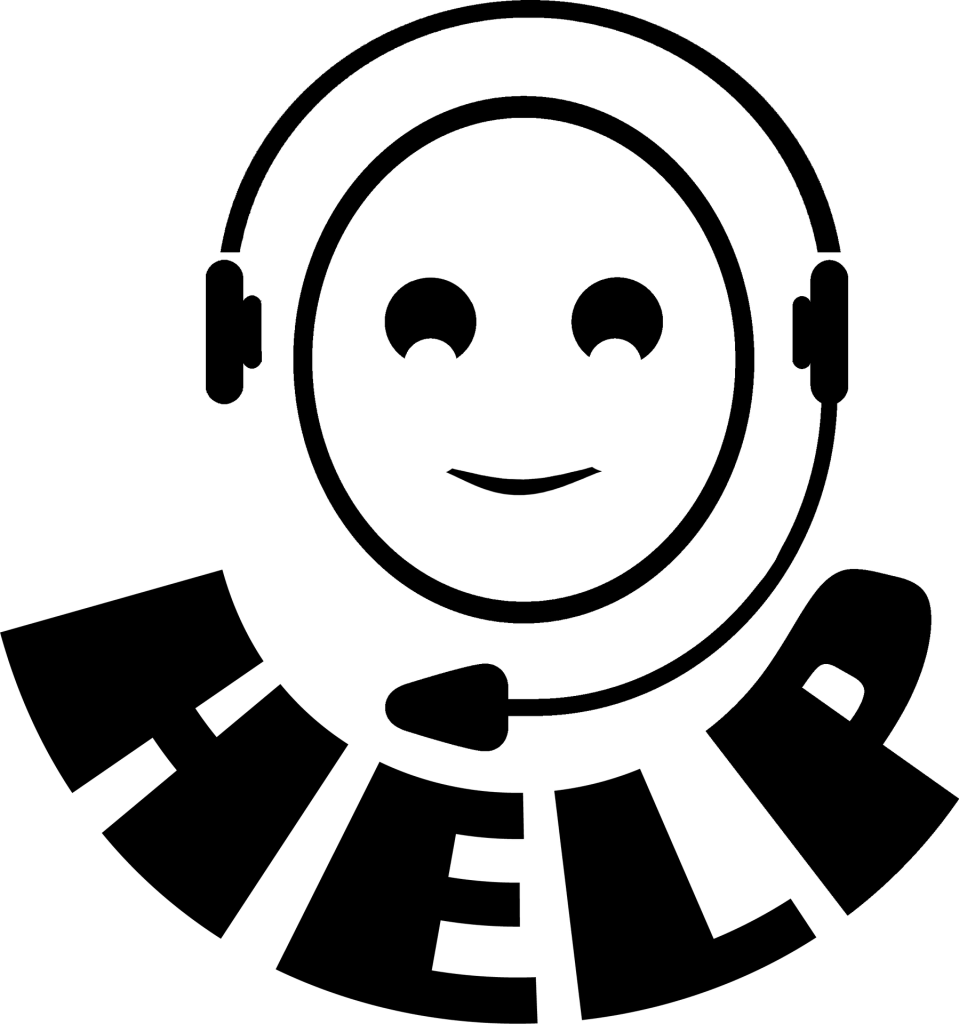Dass die Bild Unsinn schreibt – oder auch Tatsachen in abweichender Form präsentiert, das ist nicht nur mir bekannt. In letzter Zeit hat sie sich auf die Callcenter-Branche, in der ich arbeite, eingeschossen.
Ich will das nicht unkommentiert lassen.
Wie unschwer aus der Überschrift zu sehen, geht es um die Arbeitenden an den Hotlines und somit in den Callcentern.
Die letzten Beiträge in „Deutschlands größter Tageszeitung“ stellten die Lage so dar, als ob dort nur inkompetente, faule, betrügerische und unterbezahlte Menschen arbeiten. Den letzten Punkt kann man vielleicht so stehen lassen – der Rest ist eine „urban Legend“, die eben von solchen „Qualitätsjournalisten“ und „Zeitungen“ willfährig bedient, besser gesagt geschaffen, wird.
Hotline – technische Support
Das ist mein Arbeitsgebiet, ich mache diesen Job schon eine Weile und meist auch gern. Wer Interesse hat, kann dazu einiges hier lesen. Im heutigen Artikel:
Die größte Telefonaktion zu DSL- und Mobilfunk-Ärger
verspricht die Bild nun, dass morgen „Im ersten Anlauf geholfen wird“ – das haben die Anbieter der Bild versprochen.
Unsere tägliche Arbeit
Genau das ist es, im ersten Anlauf helfen – das machen wir täglich. Aber es gibt da Missverständnisse mit den Kunden. Wenn ich selbst Kunde bin, dann muss ich mir das auch immer wieder in Erinnerung rufen.
Der erste Anlauf
Ich weiche mal vom Callcenter ab und gehe auf meine alte Arbeit, also Pannenhilfe und Abschleppdienst im Auftrag des ADAC, zurück. Es war Samstagnacht, kalt und nass, ein Kunde aus Bayern stand mit seinem defekten Auto auf der A1 bei Bremen. Er war ADAC-Mitglied und hatte Anspruch auf Pannenhilfe oder Abschleppen zur nächsten Werkstatt. Das Auto hat einen Motorschaden, also nichts mit Pannenhilfe, ich schleppte es zur nächsten Werkstatt und bot dem Kunden an ihn zu einem Hotel zu fahren oder ihm einen kostenpflichtigen Mietwagen zur Verfügung zu stellen. Das war „im ersten Anlauf geholfen“, auch wenn der Kunde seine Fahrt nicht wie geplant fortsetzen konnte.
An der Hotline
Nochmal, dort sitzen meist gut ausgebildete und kompetente Mitarbeiter, versehen mit modernster Technik zur Behebung von Fehlern, die mit Fernwartung behebbar sind. Oft beschäftigen wir uns auch mit dem „Fehlerbild User“, welches nicht selten auftritt. Trotzdem ist die „Hilfe im ersten Anlauf“ oft, also öfter als uns lieb ist, z.B. der Einsatz eines Außendienst-Technikers vor Ort. Der muss terminiert werden und kann oft nicht so schnell erscheinen wie der Kunde es sich wünscht – wir würden die Kollegen gern sofort schicken, leider ist das oft nicht möglich.
Es wird wohl noch schlechter werden
Grund dafür sind weniger die Tekommunikations-Anbieter, es wollen einfach zu wenige junge Menschen diese Berufe erlernen und ein erheblicher Teil der Service-Techniker ist näher an meinem Alter, als in dem zwischen 25 und 35 Jahren.
Fazit zum Bild-Arikel
Dieser Artikel suggeriert, dass die Bild die Kunden rettet und uns ins Gesäß tritt. In Wirklichkeit machen wir diese Arbeit täglich – an 365 Tagen im Jahr und oft 24 Stunden am Tag (für die Korinthenkacḱer: Hier ist natürlich Schichtarbeit gemeint).
Jetzt Ihr, liebe Kunden und Bild-Joournalisten – Habt ihr schon mal daran gedacht bei uns zu arbeiten?
Bildnachweis: CCO Creative Commos by geralt – Thank you