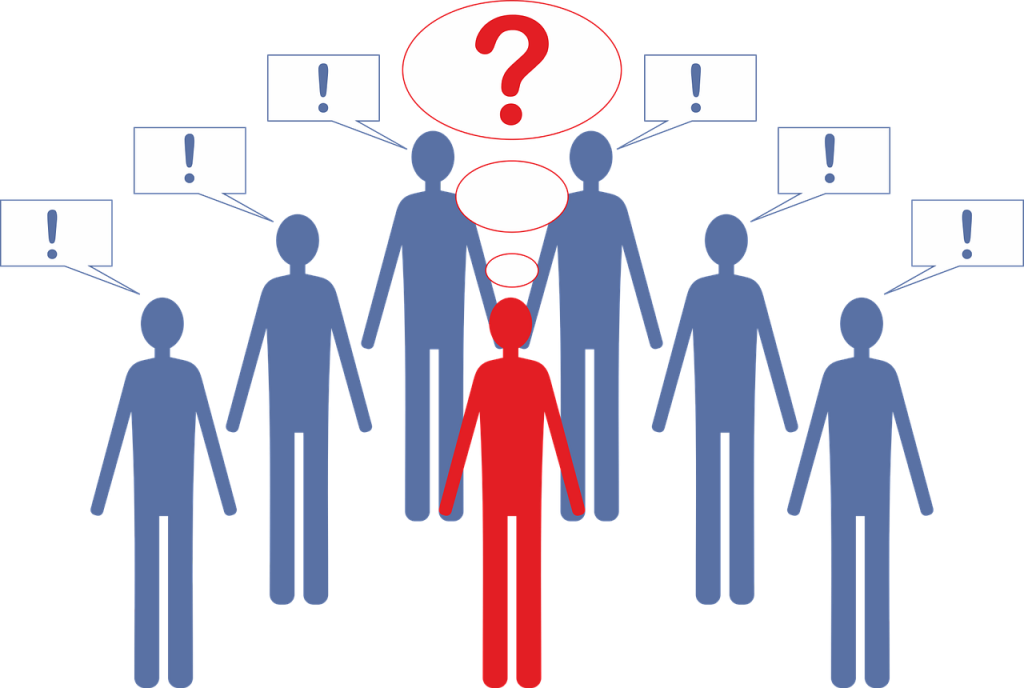Der geübte politisch interessierte Leser weiß sofort, dass es hier um den Verkehrsminister Andreas (Andi) Scheuer und die Zulassung der Elektro-Roller für den Straßenverkehr geht. Er sieht für diese ein großes Potential.
Ich habe mir dazu Gedanken gemacht.
Elektro-Roller – sinnvoll?
Lily Gabelmann (Stadträtin für die Piraten in Leipzig) hat eine Interview-Anfrage zu dem Thema erhalten und wir haben uns dazu unterhalten. Es geht natürlich nicht nur um die im oben verlinkten Artikel genannten Elektro-Tretroller, die Andi Scheuer für hilfreich hält, sondern auch um andere Elektro-Kleinstfahrzeuge (Elektrominis) die den Verkehrsstau und die damit verbundene Schadstoffbelastung in den Städten verringern sollen. Die Antwort auf die Frage nach dem Sinn, ist wie so oft: Ja – Nein – weiß nicht – der nachfolgende Text entstand aus dem Gespräch, drückt allerdings meine Meinung aus.
Elektro-Roller und Verkehrssicherheit
Nach Meinung von Andi Scheuer sollen diese Fahrzeuge bei einer möglichen Höchstgeschwindigkeit zwischen 12 bis 20 km/h auf Radwegen, falls nicht vorhanden innerorts auch auf Straßen, fahren. Sie sollen dem Fahrrad gleich gestellt werden. Als Ingenieur für Kraftfahrzeugtechnik sehe ich hier einen wichtigen Unterschied zum Fahrrad – die Radgröße. Das Befahren von innerstädtischen Straßen ist auf Grund von Schlaglöchern und „tiefergelegten“ Straßenbahnschienen schon mit Fahrrädern (24-28 Zoll Reifengröße) ein fast akrobatischer Akt. Mit den Elektrominis wird es zum Kampf gegen die physikalischen Gesetze, den die FahrerInnen dieser Gefährte nur verlieren können. Hier reden wir noch nicht von Bremsen, Beleuchtung, Signaleinrichtungen oder anderen verwirrenden Details.
Elektro-Roller gleich Fahrrad?
Wenn es nach Andi Scheuer geht, dann sollen die Elektrominis mit einer Höchstgeschwindigkeit unter 12 km/h auch auf den Fußwegen fahren dürfen. Das widerspricht der Gleichstellung mit dem Fahrrad, denn diese dürfen genau dort nicht fahren. Ausnahmen sind in der StVO § 2 Abs. 5 geregelt. Nun sollen also fast geräuschlose Fahrzeuge mit ca. 3-facher Fußgängergeschwindigkeit auf den Gehwegen fahren?
Elektro-Roller und ÖPNV
Die Elektro-Roller sollen, wenn man Andi Scheuer glaubt, besonders die „letzte Meile“ vom ÖPNV nach Hause, oder zum Arbeitsplatz überbrücken, technisch ist das sinnvoll – die Fahrzeuge haben ja eine begrenzte Batterie-Kapazität – aber ist das von Seiten des ÖPNV aus auch realistisch?
Dazu ein Zitat aus einem älteren Artikel
Ein Umstieg weiterer Personengruppen auf den ÖPNV bringt nicht nur ein erhöhtes Fahrgastaufkommen mit sich. Ist ein Umstieg auf den ÖPNV ernsthaft gewollt, dann muss auch beachtet werden, dass das „Gepäckaufkommen“ erheblich steigen wird. Ich bezweifle, dass es ein Zurück zum „Einkaufen im Quartier“ geben wird. Geschäfte, Supermärkte und Einkaufszentren sind nun mal nicht in allen Quartieren gleich verteilt und der Bürger wird nicht wie in der DDR jeden Tag etwas einkaufen wollen, er wird weiterhin den Großeinkauf bevorzugen. Daraus folgt, dass die Möglichkeit der verstärkten Nutzung von „Transporthilfen“ und des Transports von größeren Mengen von Gepäck gewährleistet werden muss. Dafür ist aber die derzeitige Ausstattung von Bahnen und Bussen nur bedingt, meist in keiner Weise, geeignet.
Zum Gepäck, Kinderwagen, Rollstühlen und Rollatoren kommen dann noch Elektrominis – da wird das Platzangebot in den Fahrzeugen des ÖPNV nicht reichen. Auch hier die Gleichstellung mit dem Fahrrad – in Leipzig muss in den Fahrzeugen der LVB für Fahrräder bezahlt werden. Gilt das dann auch für Elektro-Roller?
Elektro-Roller, die Zielgruppe
Die Zielgruppe für diese Fahrzeuge ist eindeutig die gleiche wie für das Fahrrad. Gesunde, vor allem junge, Menschen werden diese Fahrzeuge führen. Mobilitätseingeschränkte Menschen fallen hier nicht ins Gewicht, dabei ist ein erheblicher Anteil dieser (ob aus Gesundheits- oder Altersgründen) heute auf das Auto angewiesen, z.B. weil der Weg zum ÖPNV zu weit ist oder es keine Anbindung an diesen gibt. Auch hier wollen wir nicht über den Preis für Elektrominis reden – da käme nämlich noch „gut verdienend“ dazu.
Fazit:
Wir sind nicht gegen die Freigabe von Elektro-Rollern oder anderen Elektrominis für den Straßenverkehr. Wir meinen nur:
Elektro-Roller lösen kein einziges Verkehrsproblem.
Bildnachweis: under CCO by airwheel