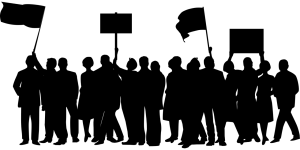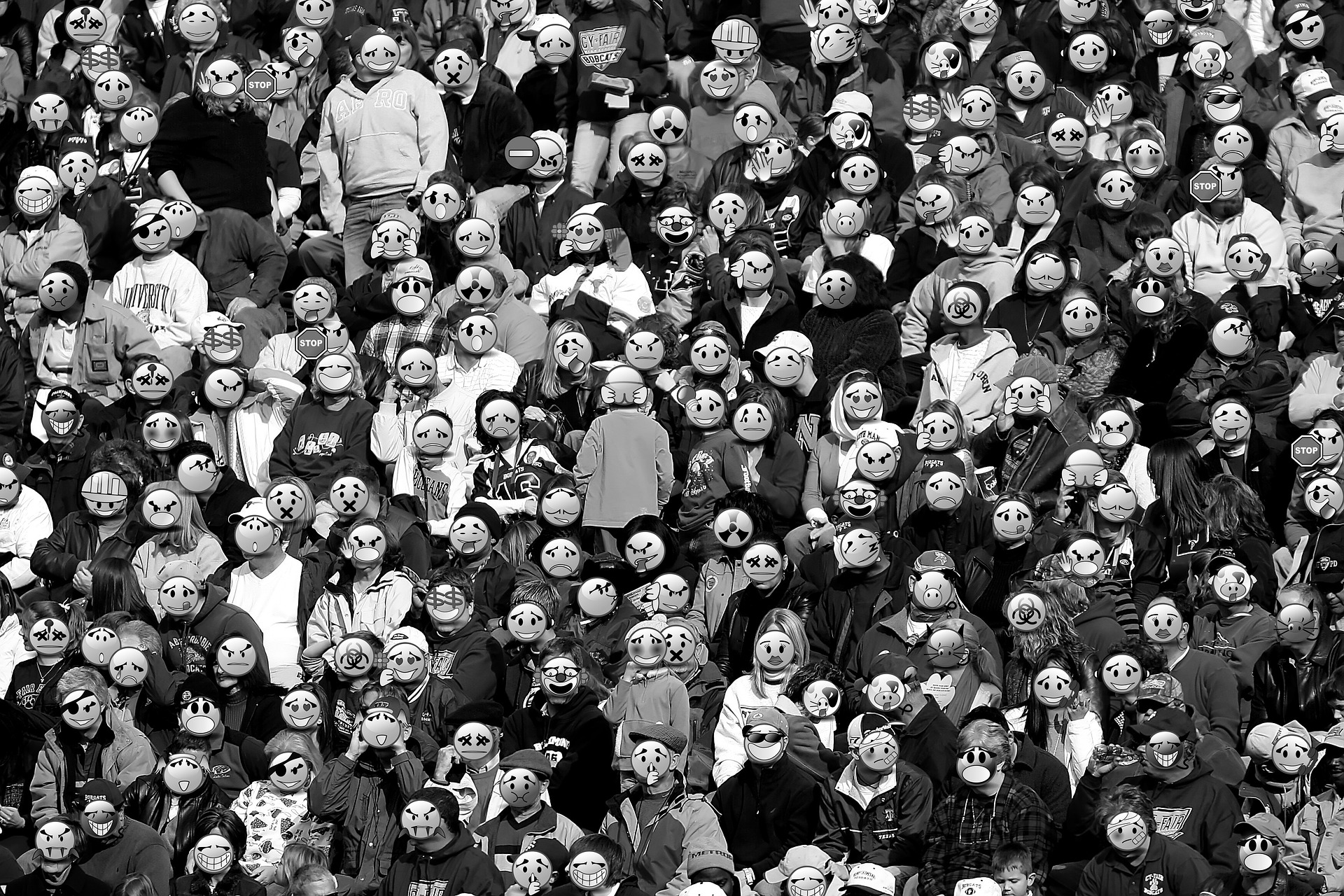Es sei mir verziehen, dass ich bei diesem Thema etwas dünnhäutig reagiere, das liegt an meiner Teilnahme an Montagsdemonstrationen 1989 in Leipzig. Daß die Stasi Mitarbeiter (nach heutigem Sprachgebrauch Zivilfahnder) in die Demo einschleust, die dann als Agent Provocateur gewalttätig werden und den „Schutz- und Sicherheitsorganen des Arbeiter- und Bauernstaates“ einen Grund zum Eingreifen geben, war eine der größten Ängste der Demonstranten.
Einleitend sei gesagt: Ich habe nicht die Absicht alle Polizisten oder die Polizeibehörden im Allgemeinen zu diskreditieren. Die meisten machen einen guten und wichtigen Job. Durch Fehlentscheidungen und Fehlverhalten kommt es aber immer wieder zu nicht hinzunehmenden Verstößen gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung in unserem Lande.
Zivilfahnder wird Agent Provocateur
Wann passiert das?
Es gibt in Deutschland ein Vermummungsverbot bei Demonstrationen, über dessen Rechtmäßigkeit und Sinnhaftigkeit man sich streiten kann. Es ist aber geltendes Recht.
Wenn also Zivilfahnder an einer Demonstration teilnehmen und sich vermummen, dann mögen sie das im Rahmen ihrer Aufgabe tun – Jeder ist aber ein Agent Provocateur, weil die uniformierten Kollegen nur Vermummte sehen und somit einen Grund zur Auflösung der Demonstration haben.
Das ist ein Fakt.
Die Sinnlosigkeit dieser Einsätze
Einen Zivilfahnder in eine Demo, hier die „Welcome to hell“ in Hamburg, zu schicken ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Was kann er tun? Eingreifen kann er, ob vermummt oder nicht, in keiner Weise – er würde sich als Polizist zu erkennen geben. Beobachten kann er nur Nichtvermummte bei Straftaten, die Vermummten kann er nicht identifizieren. Als Vermummter macht er sich unter Vermummten, im Falle der Eskalation, höchstens verdächtig wenn er nicht selbst an Gewalttaten teilnimmt. Nimmt er aber teil, dann macht er sich strafbar.
Das ist ein Teufelskreis
Der Verdacht
Ob zu Recht oder Unrecht, es wird der Verdacht entstehen, dass der vermummte Zivilfahnder als Agent Provocateur eingesetzt wird um gegen Demonstrationen vorgehen zu können.
Das wiederum diskreditiert die Polizei als wichtige und notwendige Institution.
Also hört auf damit.
Bildnachweis: under creativ commons by OpenClipart-Vectors
Edit 25.05.2018 12:15 Uhr:
Wer selbst schreibt, der kennt das. Ein Artikel ist veröffentlicht und mir fällt noch etwas dazu ein. Hier sind das zwei Fragen:
- Wenn der Veranstalter einer Demo einen Vermummten dazu zwingt, evt. mit körperlichem Einsatz, die Vermummung abzulegen oder die Demo zu verlassen und dieser sich dann als Zivilfahnder herausstellt – ist das dann Angriff auf einen Polizeibeamten?
- Wenn ein Zivilfahnder auf eine Demo geschickt wird auf der die Teilnehmer überwiegend verfassungsfeindliche Symbole tragen – ist er dann auch dazu berechtigt? Was passiert, wenn die Demo aufgelöst wird und es stellt sich heraus, dass die Zivilfahnder die einzigen waren die diese trugen?
Wie gesagt, besser ist es diese Praxis aufzugeben.