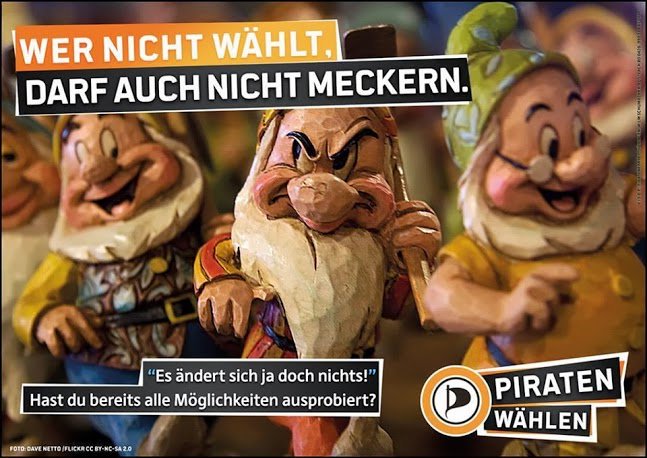Am 07. Oktober 2020, witzigerweise am alten „Tag der Republik“ in der DDR, wurde der neue Sitzungssaal im Neuen Rathaus der Stadt Leipzig eingeweiht. Es fand auch eine bildungspolitische Stunde statt, diesmal unter dem Thema „Politische Bildung“. Als Vertreter der kleinsten Fraktion im Stadtrat wusste ich, dass ich als letzter spreche. Die Danksagungen an und Aufzählungen von Akteuren, mit denen man eine solche Rede gewöhnlich füllt, konnte ich mir also sparen. So beschloss ich über die Prinzipien der Aufklärung und Humanismus zu sprechen – ganz auf meine Art. Nachfolgend der Text, der natürlich beim Vortrag evt etwas modifiziert wurde. Im Grunde blieb er aber unverändert. Eingangs betonte ich meine eigene Kindheit und Jugend, die in zwei indoktrinären Systemen stattfand – dem Katholizismus und dem DDR-Bildungssystem.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte ReferentInnen, werte Damen und Herren Beigeordnete, Kolleginnen und Kollegen Stadträte, Liebe Zuschauer im Saal und am Livestream, Werte Pressevertreter
Das Zeitalter der Aufklärung liegt schon über 300 Jahre in der Vergangenheit, doch seine Themen sind – meiner Auffassung nach – immer noch so aktuell wie eh und je. Immanuel Kant, selbst einer der großen Aufklärer, definierte die Aufklärung hierbei wie folgt:
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.
Was hat das nun mit der politischen Bildung zu tun? Hierzu die Definition von Wikipedia:
Das Ziel der politischen Bildung ist, Zusammenhänge im politischen Geschehen zu erkennen, Toleranz und Kritikfähigkeit zu vermitteln und zu stärken, damit zur Herausbildung und Weiterentwicklung von aktiver Bürgerschaft, gesellschaftlicher Partizipation und politischer Beteiligung beizutragen.
Es ist das Ziel der politischen Bildung, Menschen zu befähigen, dem Kernprinzip der Aufklärung zu folgen – sich also selbst eine eigene Meinung zu bilden.
Politische Bildung ist nicht zu verwechseln mit politischer Erziehung, welche schnell in Indoktrination umschlagen kann. Manche unter uns kennen ein solches System wir zum Beispiel aus der ehemaligen DDR, mit Staatsbürgerkundeunterricht und ähnlichem. Hier wurde die „Leitung des Verstandes“, wie Kant es ausdrückt, durch die Aussagen von politischen, im Besonderen auch religiösen Führern ersetzt. Das Ziel ist, egal wie positiv ausgedrückt oder mit welch fortschrittlichen Ideen initiiert, eine Überlagerung der individuellen Meinungen und stellt somit einen Herrschaftsanspruch dar.
Ich möchte hier auch explizit auf den Artikel 21 des GG hinweisen: „(1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.“ Sie „wirken mit“, das bedeutet also im Sinne der politischen Bildung, dass keine Partei einen Anspruch auf eine direkte Einflussnahme der Inhalte jener besitzt.
Beschränken wir also die politische Bildung auf die Vermittlung der Kenntnisse über das demokratische System unseres Landes und die Fähigkeit zur Nutzung der Instrumente der Demokratie durch die mündigen BürgerInnen – wie können wir dann extremistische Meinungen verhindern?
Für mich steht hier das humanistische Menschenbild in seiner einfachen Form im Vordergrund: „Ein Mensch ist ein Mensch.“ So wie es in der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ von 1948 heißt: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ So wie es das Grundgesetz in Artikel 3 ausdrückt: „Alle Menschen sind (vor dem Gesetz) gleich.“,wobei ich hier das „vor dem Gesetz“ auslassen würde.
Auch religiöse Definitionen kann man hier gelten lassen. Wie zum Beispiel das „Liebe Deinen Nächsten so wie Dich selbst“ aus dem Neuen Testament. Ich weiß, der Herr Jung, als studierter Religionslehrer, verzieht jetzt das Gesicht, wie immer wenn ich von Religion rede.Der Begriff „Nächster“ ist hier zwar nicht definiert, er schließt aber auch niemanden explizit aus. Problematisch an diesem Satz ist nur, dass man sich selbst – allerdings nicht im narzisstischen Sinne – lieben muss um andere zu lieben. Das ist leider nicht selbstverständlich in Zeiten der allgemeinen Unzufriedenheit. Ich erinnere hier an das bekannte Internet-Meme in dem Jesus predigt „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“ und ein Zuhörer fragt „Und wenn er schwul ist, oder schwarz?“ Jesus antwortet dort „Hast Du was an den Ohren?“
Auch die Achtung der Natur, ergo der Umwelt, sowie der anderen Lebewesen lässt sich ohne Indoktrination vermitteln. Allein die Vermittlung der Lebensnotwendigkeit einer intakten Umwelt für die Menschen sollte dort für den Anfang ausreichend sein. Wenn,hier komme ich wieder auf den religiösen Aspekt zurück, jemand lieber von der „Bewahrung der Schöpfung“ reden möchte, dann ist das auch akzeptabel. Solange jede Schöpfung gemeint ist – also Rotkäppchen, die Großmutter, der Jäger, der Wald, der Wolf und die frische Luft.
Warum also dieser Exkurs in die Bildungsphilosophie?
Friedrich Nietzsche ließ seinen „tollen Menschen“ durch die Straßen laufen und rufen „Gott ist tot“ – ich möchte nicht postulieren müssen „Die Aufklärung ist tot“.
Wir erleben heute wieder die Versuche der Indoktrination, egal von welcher politischen Seite. Das ist gefährlich, weil es die Freiheit des Denkens einschränkt und letztendlich das Denken behindert. Der indoktrinierte Mensch folgt den „Lehren“ – er hinterfragt nicht, er lässt keine Meinung außer der angeblich eigenen, die nicht wirklich seine ist, zu und verteidigt diese mit allen Mitteln.
Der indoktrinierte Mensch ist kein Freier Mensch, er unterliegt der Herrschaft des Meinungsführers. Passend dazu ein Zitat aus „Der Eunuch“ von Johannes Tralow, er lässt seine Protagonistin Julienne sagen:
„Sie sagten, die Sklaverei sei die tiefste Erniedrigung und vollständigste Ausbeutung, zu der Menschen jemals gezwungen wurden oder … sich hergaben. Für mich ist der letzte Zusatz ‚oder sich hergaben‘, das Schrecklichste.“
Der Verzicht auf die Nutzung des eigenen Verstandes – im Sinne der Aufklärung – ist für mich das „sich hergeben in die geistige Sklaverei“.
Demokratie braucht aber den, im Sinne der Aufklärung, freien Menschen – der „ohne die Anleitung eines Anderen“ seinen Verstand nutzen kann.
Die Aufklärung braucht keine Aufklärer der nicht zum Denken anregt sondern sagt was man zu denken hat, dieser wäre eine Absurdität.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay