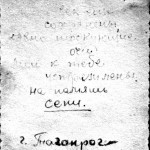Wenn ich so an 1989 denke, dann ist der 9. November ein, wenn auch ungewollter, Schlusspunkt der Ereignisse des Herbstes.
In einem Beitrag beschrieb ich schon die Rückschau, die wir zum endgültigen Ende der DDR am 2. Oktober 1990 hielten. Aber der 9. November, mit der Maueröffnung lag da ja schon fast ein Jahr zurück.
Die ZEIT hat mit „Ist das ein Deutscher Held“ schon den ersten Artikel über die Maueröffnung gebracht, hier also meine ganz persönlichen Erinnerungen.
Einen Monat zuvor hatte die DDR-Regierung vor den Demonstranten in Leipzig kapituliert. Die von Krenz angesprochene „chinesische Lösung“ wurde nicht durchgeführt. Lassen wir die Demonstranten mal außen vor dann sehen wir, dass es zumindest in den regionalen Führungsstäben der bewaffneten Organe und auch der SED durchaus Leute gab, die die Zeichen der Zeit erkannten. Ich will diese hier nicht zu Helden stilisieren, aber ihre Resignation hatte an der Verhinderung einer gewaltsamen Lösung durchaus einen großen Anteil. Auch spektakuläre Aktionen, wie der Aufruf der „Leipziger Sechs“ am 9. Oktober spielte ein zwar große, aber nicht die entscheidende Rolle. Die Gewaltlosigkeit war von Anfang an auf der Seite der Demonstranten ein Muß. Ich erinnere mich an die erste Montagsdemo, an der ich teilnahm, dort wurde im Demonstrationszug ständig durchgesagt „Keine Gewalt!“ und jeder sah auf seinen Nebenmann (oder auch Frau), es war sozusagen selbstregulierend.
Es war ja das Ziel der damaligen Demonstranten, eine neue DDR zu schaffen. Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und andere Forderungen sollten in der DDR gewährleistet werden. Die meisten hatten nicht die Wiedervereinigung im Sinn.
Nach dem 9. Oktober kamen aber dann vermehrt Deutschlandfahnen ins Spiel und Parolen wie „Deutschland einig Vaterland“ oder „Kommt die D-Mark nicht zu mir, dann gehe ich zu ihr!“. Einige von den ersten Teilnehmern nahmen nun nicht mehr teil.
Am 4. November fand nun die erste genehmigte Großdemonstration auf dem Berliner Alexanderplatz statt. Auch als Demonstration der Kulturschaffenden bekannt und als „Meilenstein der friedlichen Revolution“ bezeichnet. Durch diese wurde, wie einige Institutionen ihn inzwischen geadelt haben, der Berliner Alexanderplatz zum „zentralen Ort der friedlichen Revolution“.
Aber die Revolution war ja eigentlich schon vorbei. Die war am 9. Oktober, nicht nur in Leipzig.
Am 9. November 1989 wussten eigentlich schon alle, dass die DDR am Ende angekommen war. Die Frage war nur „Wie lange dauert die Agonie?“
Das löste sich mit der Ankündigung von Schabowski um 18.53 Uhr. Mitgekriegt haben wir es zu dieser Zeit nicht. Erst etwas später sahen wir die Pressekonferenz im Fernsehen und haben uns natürlich gefragt „Und nun?“. Wir beschlossen nicht nach Berlin zu fahren, die Grenzöffnung war vollzogen, die Party konnte auch ohne uns stattfinden.
Ich bin dann erstmalig um den 15. Dezember herum nach Westdeutschland gefahren, Weihnachtseinkäufe machen. Besuche konnte ich nicht machen, da gab es niemanden.
Im Sommer 1990 machte ich dann aber zwei Dinge, die ich immer mal machen wollte. Ich ging zum Brandenburger Tor und zur Glienicker Brücke. Das war wichtig, sozusagen symbolisch.
22 Jahre später, ich bin immer noch ich. 10 Jahre Leben in Bremen und die Rückkehr nach Leipzig haben mich auch nicht groß verändert – nur älter gemacht.