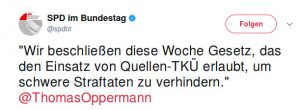Im Internet tobt ein Shitstorm gegen die CDU/CSU und ihr Regierungsprogramm, weil sie in diesem die Vollbeschäftigung in Deutschland als Ziel benennt.
Bevor ich auf diese Zielstellung komme, einige Bemerkungen zum Generalsekretär der CDU Peter Tauber und seinem Tweet von gestern.
Ich hätte diesen Tweet gern als Wahlversprechen mit der Aussage:
„Wir kämpfen dafür, dass zukünftig jede/r mit guter (ordentlicher) Ausbildung einen Job hat, der menschenwürdige Arbeitsbedingungen und eine auskömmliche Bezahlung bietet.“
Vielleicht hätte er auch von „in Würde davon leben können“ sprechen können, das wäre aber zu viel  Schulz für ihn gewesen.
Schulz für ihn gewesen.
Schön wäre es gewesen, zwar nicht ausreichend aber ein Anfang. Er hat das heute aber selbst korrigiert, indem er schrieb:
Es tut mir leid, dass ich mein eigentliches Argument – wie wichtig eine gute Ausbildung und die richtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, damit man eben nicht auf drei Minijobs angewiesen ist.
Die Wichtigkeit dieser Kriterien steht außer Frage, also buche ich diese Diskussion als sinnlos ab und wende mich dem Regierungsprogramm der CDU/CSU (pdf), in Sachen Arbeit, zu.
Gute Arbeit auch für Morgen – Vollbeschäftigung für Deutschland
So die Überschrift für den Teil Arbeit – dem stimme ich zu, wenn ich hier auch Widerspruch aus meinem eigenen politischen Lager erwarte. Dieser Widerspruch wird sich nicht gegen die Forderung nach „Guter Arbeit“ sondern gegen die auf „Vollbeschäftigung“ richten.
Zum politischen Aspekt der Vollbeschäftigung habe ich meine Meinung lang und breit dargelegt, das kann jede/r hier nachlesen.
Zurück zum Regierungsprogramm der CDU/CSU.
Unter „Arbeitsplätze sichern“ wird etwas angestrebt, was nicht funktionieren wird. Die alte Industrie, besonders die Automobilindustrie, soll mit ihren Arbeitsplätzen erhalten werden. Das ist Utopie, denn mit der so genannten „Industrie 4.0“, der Einführung der Elektromobilität und anderen Fortschritten wird sich die alte Industrielandschaft verändern – sie tut es jetzt schon.
Somit werden die unter „Neue Arbeitsplätze schaffen“ im ersten Punkt benannten Arbeitsplätze nicht zusätzlich entstehen. Sie werden alte Arbeitsplätze ersetzen und dies erwartbar in geringerer Anzahl.
Hier rede ich natürlich von Arbeitsplätzen in der Industrie – die Arbeit wird uns, meiner Meinung nach, aber nicht ausgehen. Dazu komme ich später.
Der später aufgeführte Fachkräftemangel ist hausgemacht.
Zum einen haben wir die Fachkräfte, sie sind aber am falschen Ort. Ein Ortswechsel scheitert oft daran, dass der Zuzug zum neuen Arbeitsort (das gilt besonders in den Ballungsräumen) an fehlendem oder unbezahlbarem Wohnraum scheitert. Für Familien mit schulpflichtigen Kindern kommt dazu, dass der Umzug in ein anderes Bundesland für das Kind schon fast vergleichbar ist mit einem Umzug ins Ausland – Grund: unser föderales Bildungssystem.
Ein anderer Grund liegt in den Versäumnissen bei der (betrieblichen) Aus- und Weiterbildung. Fachkräfte, die benötigt werden, kommen ja meist nicht aus einem Studiengang – sie sind in ihrer beruflichen Tätigkeit dazu geworden. Wenn die Wirtschaft heute Fachkräfte aus dem Ausland fordert, dann will sie diese in ausländischen Unternehmen abwerben – weil sie sich der Aus- und Weiterbildung eigener Kräfte, aus kurzfristigen Profitgründen, verweigert hat.
Dass die zwei Punkte bei der Ausbildungs- und Fachkräfteproblematik, die ich nachfolgend zitiere, nicht in Übereinstimmung gebracht werden können, sehe vielleicht nicht nur ich so.
Zudem wollen wir gerade junge Menschen zwischen 25 und 35 ohne Abschluss nachqualifizieren , …
und
Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter steigen aufgrund unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der rückläufigen Zahl junger Menschen, die neu ins Erwerbsleben eintreten.
Ein großer, wenn nicht der größte, Teil der im ersten Zitat genannten jungen Menschen ist während der Regierungszeit von CDU/CSU aus dem Bildungs- und/oder Ausbildungssystem ausgestiegen. Wenn die Anzahl der jungen Menschen jetzt geringer wird, leisten wir uns das dann erneut?
Bevor ich das Thema Regierungsprogramm beende noch ein Hinweis:
Auf Seite 12 des Regierungsprogramms findet sich folgende Aussage:
Leistung muss sich lohnen. Wer sich anstrengt, muss mehr haben als derjenige, der dies nicht tut. CDU und CSU stehen für Leistungsfreude und Fairness.
Vielleicht erinnert sich jemand an die Jacobs-Werbung mit Frau Sommer, da hieß es:
„Ich gebe mir doch immer so viel Mühe!“ Antwort: „Das allein genügt nicht…“
So klingt „Wer sich anstrengt…“. Ein Arbeitnehmer in dessen Arbeitszeugnis steht: „Er hat sich immer angestrengt.“ hat es bei der Arbeitssuche schwer. Der Begriff ist geradezu ein Verstoß gegen das Leistungsprinzip – aber damit kann ich leben.
Die Arbeit wird uns nicht ausgehen
Das habe ich als meine Meinung geschrieben und ich möchte es begründen.
Natürlich wird der Anteil der industriellen (wertschöpfenden bei Marx) zurückgehen. Wir leiden aber jetzt schon an Arbeitskräftemangel im medizinischen Bereich, in der Pflege, in der Kinderbetreuung, im Bildungswesen und anderen Bereichen, nicht zu vergessen den Arbeitskräftebedarf für die Instandsetzung und Erweiterung der maroden Infrastruktur.
Der eine Teil des Problems ist die finanzielle Ausstattung der Bereiche – ein fast wichtigeres Problem ist aber die schlechte Bezahlung der Arbeitskräfte. Aus dem Mangel an Arbeitskräften (nicht nur, aber zu großen Teilen) entstehen dann unerträgliche Arbeitsbedingungen.
Wir müssen, meiner Meinung nach, hier die alte Bewertung der Arbeitskraft, nach Höhe der Wertschöpfung, durch die Bewertung nach gesellschaftlicher Relevanz ersetzen.
Sonst behalten wir den Zustand bei, dass ein Bandarbeiter bei BMW für eine angelernte Tätigkeit ein Mehrfaches des Lohnes einer ausgebildeten Altenpflegern erhält. Damit behalten wir auch die o.g. Probleme.
Zum Abschluss:
Sollte uns bei Vollbeschäftigung doch einmal die Arbeit ausgehen, dann möchte ich daran erinnern, dass auch eine Verkürzung der Tages-, Wochen- oder Lebensarbeitszeit für alle möglich ist.