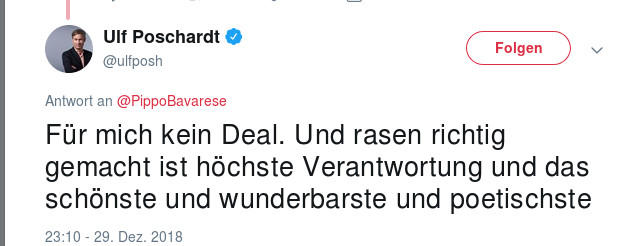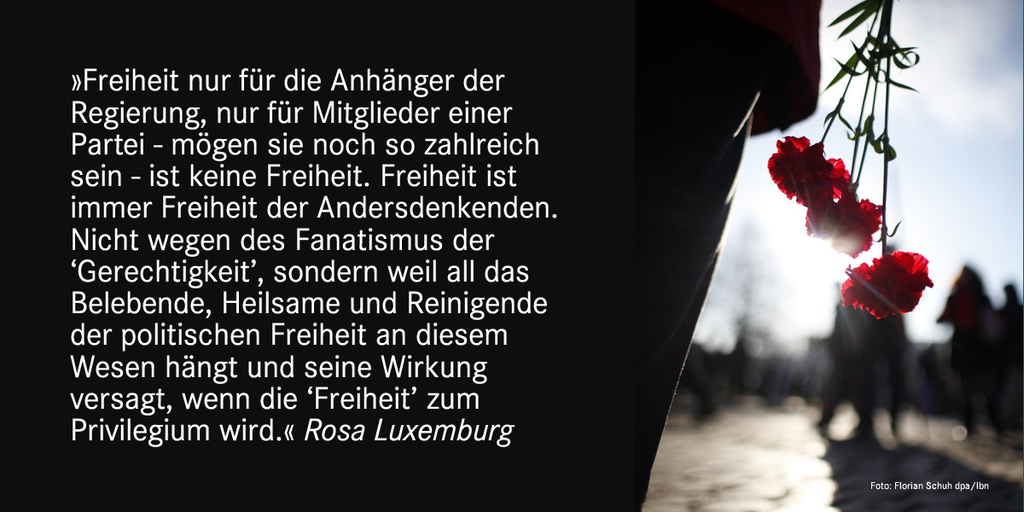Ich habe lange nichts über Callcenter geschrieben – seit dem letzten Mal hat sich aber nicht viel geändert was das Ansehen der dort Beschäftigten betrifft. Also heute mal ein kleiner Insider-Einblick. Der ist nicht immer ganz ernst ausgedrückt, dafür aber ehrlich.
Callcenter – mein 8. Jahr
Es ist wirklich schon fast 8 Jahre her, seit mein Bearbeiter beim Arbeitsamt sein Unverständnis äußerte weil ich mich im Callcenter beworben hatte. Na ja er konnte mir ja keinen meiner Ausbildung und Arbeitserfahrung entsprechenden Job vermitteln und ich meinte, dass ich irgendwie aus der Nummer wieder raus käme. Also begann ich im Verkauf (inbound) wechselte noch zweimal den Arbeitgeber und mache nun schon wieder fast 6 Jahre technische Support für einen führenden Telekommunikationsanbieter. 2012 begann ich dann meine Erfahrungen hier im Blog aufzuschreiben und musste mir von einem mir nahe stehenden Akademiker sagen lassen, dass ich mit meine Artikeln meine Arbeit dort aufwerten wolle. Ist eben seine Meinung, nicht meine Intention. Heute mal ein etwas persönlicher Artikel.
Callcenter – Freitag Frühschicht
Es ist gegen 05.15 Uhr als die ersten eintreffen. Ich habe im Radio den Spruch gehört „Früh aufstehen – müde und kaputt. Nach dem Duschen müde, kaputt aber nach Vanille duftend.“ genau so geht es mir, nur mit anderem Duft. Morgenroutine beginnt: Rechner hochfahren,Programme starten, mit den KollegInnen dumme Sprüche austauschen, lachen – das alles bei gedimmter Beleuchtung. Die erste Führungskraft kommt, schaltet die Beleuchtung hell – ein allgemeiner Aufschrei, alles wie immer. Noch schnell auf den Raucherplatz, ein bisschen lästern über die Vorgesetzten und KundInnen und Punkt 06.00 Uhr online gehen – keine KundInnen weit und breit. Es ist verdammt früh, es ist kalt draußen, manche KollegInnen sind seit 03.00 Uhr auf den Beinen, wir arbeiten im „nahe dem Mindestlohn-Sektor“, stehen ganz unten im gesellschaftlichen Ansehen und es herrscht eine gute Stimmung.
Callcenter – KollegInnen
Hier geht es nicht um „Teamspirit“, Schicksalsgemeinschaft oder irgend so einen Unsinn, im Callcenter treffen Menschen aufeinander die es gewöhnt sind zu kommunizieren. Nicht irgendwelchen Unsinn zu erzählen sondern, jeder auf seine Weise, sich präzise auszudrücken. Hier arbeiten Menschen die mit anderen Menschen mit den verschiedensten Hintergründen reden können (müssen). Zumindest die meisten der KollegInnen ticken so, es kommt also vor dass die junge Kollegin die einen neuen Mann sucht sich mit dem Kollegen austauscht dessen Mann gerade Stress macht – beide ziehen über die Männer her „Die Kerle taugen eh nichts!“. Auch Peter, die jetzt Petra heißt (der Name ist natürlich fiktiv), oder der muslimische Kollege gehören einfach so dazu. Das ist normal, zumindest hier. Klar gibt es Diven, eher zurückhaltende KollegInnen aber im Allgemeinen gehören alle zur Meute.
Nachtrag 31.01.2018: Im Callcenter kann es Dir auch passieren, dass Dir der Kollege Hobby-Imker auf die Schulter klopft und Dir den bestellten Honig auf den Tisch stellt. Es gibt schon tolle Menschen dort.
Callcenter – KundInnen
Die Ruhe dauert nicht lange, die ersten KundInnen sind in der Line und die tägliche Arbeit geht los. Telefon-, Internet- und Fernsehstörungen wollen behoben werden, Nachfragen zu Aufträgen müssen beantwortet werden und manche KundInnen müssen auch darauf hingewiesen werden, dass ein Vertrag einen Leistungsinhalt beschreibt und Sonderleistungen nicht vorgesehen sind. Nun mag ich den Begriff „KundIn“ nicht besonders, im Deutschen klingt das immer nach kaufen und verkaufen. Ich würde KlientIn bevorzugen. Als Supporter stehe ich oft zwischen den Bedürfnissen und Forderungen der KlientInnen und denen meines Arbeitgebers. Manchmal muss ich dann den Supportrahmen etwas dehnen, natürlich ohne zu fragen weil: „Es ist einfacher Verzeihung zu erlangen als eine Genehmigung zu erhalten“. Die Abwägung zwischen KlientInnenzufriedenheit und Arbeitgeberzufriedenheit ist manchmal schwer, aber möglich. Das zeigt die von den KlientInnen geäußerte Zufriedenheit mit meiner Arbeit, der Arbeitgeber ist auch nicht ganz unzufrieden.
Callcenter – „Ich liebe meinen Beruf“
Das ist hier natürlich der sarkastische Stoßseufzer bei schwierigen Fällen oder KlientInnen. Wobei beide meist auf „Fehler 30“ auf einer Seite zurück zuführen sind. Das bedeutet, der Fehler sitzt 30 cm vor dem Bildschirm also KlientIn oder SupporterIn. Hier kommt oft beiderseitig ein Missverständnis zum Vorschein. KlientInnen denken, dass SupporterInnen wissen, was sie wo an Geräten haben und wie diese verbunden sind. SupporterInnen denken, dass die KlientInnen irgendwie Ahnung von und Wissen über die Materie „Telekommunikation“ haben müssen. Da muss man sich manchmal zurücknehmen – auf beiden Seiten – um auf Augenhöhe zu bleiben. Dazu schrieb ich schon etwas. Auch das Lachen muss ich mir manchmal verkneifen. Es ist nicht verwunderlich wenn der 76jährigen Rentnerin nicht auffällt, dass das WLAN am Router ausgeschaltet ist. Passiert das dem, der sich mit den Worten „Ich habe IT studiert und weiß Bescheid“ vorstellte, ist es schon schwerer ernst zu bleiben. Diese Fehler passieren auch auf der SupporterInnen-Seite, z.B. wenn man nicht merkt, dass man gerade mit dem einen Klienten spricht – aber im System einen anderen bearbeitet. Das ist, bemerkt man es nicht rechtzeitig, allerdings nicht zum Lachen.
Callcenter – „We love to entertain you“
Das ist auch etwas ironisch gemeint, aber nicht ganz unwahr. Ich schrieb vor längerem welche Anforderungen KlientInnen an uns stellen:
„Alle wollen eine/n kommunikationsstarke/n, technisch hochkompetente/n TelefonseelsorgerIn mit Nehmerqualitäten. Wenn Diese/r dann auch noch EntertainerIn ist, dann sind die KundInnen mit dem Schmuddelkind zufrieden.“
Das Entertainment ist hier einfach die Unterhaltung mit KlientInnen – die meisten freuen sich wenn man sich wirklich für sie interessiert. Ob nun die Frage nach dem brabbelnden Säugling oder dem bellenden Hund im Hintergrund oder, besonders bei SeniorInnen, nach den Interessen bei der Internetnutzung. So am oben beschriebenen Freitag, da gab es den über 70jährigen Maschinen-Schlosser der mir gleich den SES empfahl wenn ich in Rente gehe. Für diesen ist er noch ab und zu weltweit unterwegs um Maschinen zu reparieren, die die jungen Kollegen nicht mehr kennen. Auch der Lokalreporter aus Hamburg, mit dem ich über Egon Erwin Kisch und Journalismus sprach war ein Highlight. Aber auch von anderen KlientInnen hört man viel Neues und Interessantes – man muss nur wollen und den Job darüber nicht vernachlässigen.
Callcenter – Pausen
Pausen sind fast wie überall, es wird gequatscht über Privates und auch Politik, gelästert und gemeckert über Firma und Vorgesetzte und es werden Erfahrungen mit technischen Herausforderungen, exotischen Fehlern und KlientInnen ausgetauscht. Der Unterschied ist, wie oben beschrieben, dass die KollegInnen die Kommunikation beherrschen und meist ohne es zu bemerken auf einem höheren Niveau kommunizieren als üblich. Nicht alle können das, aber sehr viele. Das ist durchaus angenehm für einen wie mich.
Fazit
Bei allen Widrigkeiten und Einschränkungen ist die Arbeit im Callcenter nicht so schlecht wie ihr Ruf. Die meisten Menschen auf beiden Seiten der Line sind tolle Menschen.
Das musste ich hier mal sagen!
Bald ist Montag – Spätschicht bis 24.00 Uhr mit graut es davor, aber irgendwie freue ich mich auf euch.
Bildnachweis: under CCO by seografika