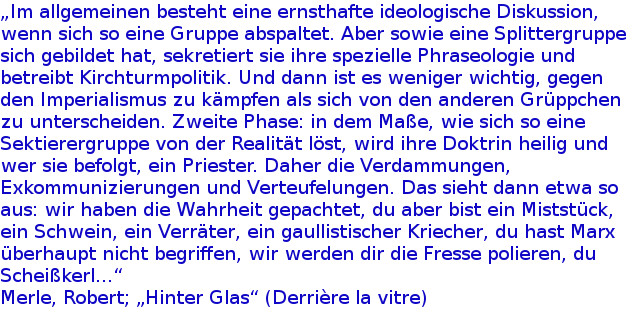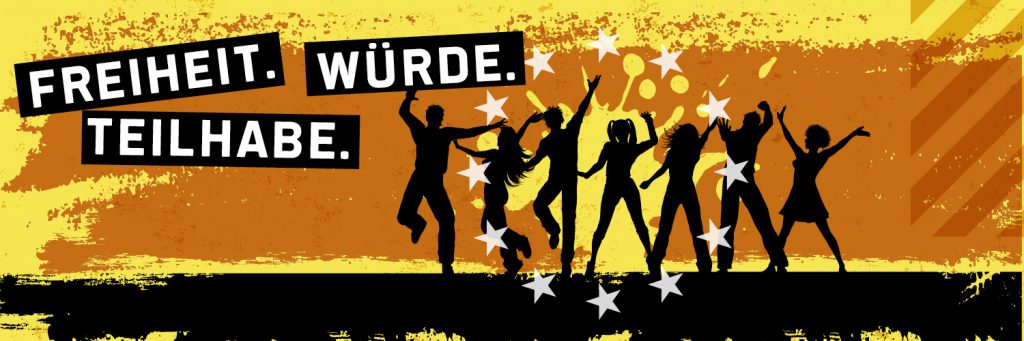Die Corona-Pandemie hat nicht nur Deutschland fest im Griff und es wird hektisch reagiert und regiert. Allgemeinverfügungen werden erlassen; Bund, Länder und Gemeinden versuchen miteinander – manchmal auch gegeneinander – Probleme zu lösen; Hilfsprogramme werden aufgelegt; Applaus von den Fenster und Balkonen für MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen wird gespendet; das Klopapier wird knapp und vieles andere mehr passiert. Zu alledem will ich mich hier nicht äußern – ich möchte in die Zeit nach Corona schauen, soweit es mir möglich ist.
Es werden mehrere Artikel, zum Anfang sei gesagt:
„It‘s the End of the world, as we know it!“
frei nach REM – und ich weiß nicht ob der Teil „And I feel fine“ zutreffen wird. Schauen wir mal, was bei meinen Überlegungen so rauskommt. Achtung Spoiler: Ich weiß es auch noch nicht!
Gesellschaft – Entschleunigung
Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben einen Entschleunigungs-Effekt in der Gesellschaft mit sich gebracht. Kurzarbeit, Home Office, Schließung von Schulen, Kitas, Läden, Restaurants, Kinos und anderen Einrichtungen habe dazu geführt, dass der Verkehr, für alle Verkehrsträger, abgenommen hat und die Warenumsätze in vielen Branchen eingebrochen sind. Ich will hier weder die Maßnahmen in Gänze verteidigen, noch die damit entstandenen Probleme beschönigen oder klein reden, aber es ist ein Fakt.
Viele Menschen werden in der verordneten teilweisen Konsumpause (nach den Hamsterkäufen) vielleicht überlegen, ob die bisherigen Konsumgewohnheiten wirklich notwendig waren. Ob nun Fernreisen in den Kurzurlaub, das jährlich neueste Smartphone, die zehn Billig-T-Shirts vom Discounter die einmal oder nie getragen wurden oder ähnliche Dinge (ich bediene hier bewusst Klischees) werden eventuell auf den Prüfstand gestellt.
Die Entschleunigung des Lebens im „Pandemie-Modus“ kann allerdings auch einen Konsumrausch nach diesem mit sich bringen, vergleichbar dem der Nachkriegsjahre im „Wirtschaftswunder“. Wir werden sehen.
Industrie und Arbeitsplätze
Wenn es in der Politik um Wirtschaft und Industrie geht, dann fällt immer der Ausspruch „Denkt an die Arbeitsplätze!“, so wird auch mit den staatlichen Hilfsprogrammen im Sinne „Sicherung der Arbeitsplätze“ gehandelt. In Deutschland steht natürlich die Automobilindustrie im Fokus der Betrachtungen, deshalb nehme ich diese hier als Beispiel.
Ich betrachte hier ausdrücklich nicht die Probleme der Menschen die jetzt durch Kurzarbeit, Zwangspausen und eventuell Jobverlust betroffen sind. Schließlich gibt nicht nur die tarifvertraglichen ArbeitnehmerInnen in den Konzernbetrieben, sondern auch die prekären Beschäftigten in Zuliefer- und Dienstleistungsbetrieben, deren Probleme liegen auf der Hand.
„Die Arbeitsplätze sind gefährdet“ – das Mantra der Politiker, Wirtschaftsweisen und Gewerkschaften – sollte uns nicht davon abhalten einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.
Werden jetzt deutsche Autos weltweit knapp? Sind die Autos, die jetzt fahren, alle vom plötzlichen Stillstand bedroht? Oder geht es darum den Kreislauf der Erneuerung der Fahrzeugflotten aufrecht zu erhalten um die Produktion neuer Fahrzeuge zu rechtfertigen?
Wir reden bei der jetzt stillgelegten Produktion ja nicht wirklich nur von Fahrzeugen mit neuen Antriebstechnologien, die unbedingt alte „schädliche“ Fahrzeuge ersetzen müssen. Wir reden von einer Industrie die die geplante Obsoleszens zur Kunstform und zur Richtlinie ihres Handelns erhoben hat.
Die Entschleunigung der Produktion trifft die Arbeitskräfte (Existenz), den Staat (Steuern), die Automobilkonzerne (Umsatz/Gewinn), die Zulieferer (Existenz) – aber es stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit des bisherigen Wirtschaftens.
Verkehr – Pandemie
Wenn die Pandemie vorbei ist, dann werden sich viele Menschen die Frage stellen:
„Bin ich im ÖPNV, oder der Bahn ausreichend vor Infektionen geschützt? Fahre ich besser mit dem Auto?“
Das ist verständlich und widerspricht natürlich dem Erfordernis nach Reduzierung des Automobilverkehrs. In Leipzig ist die Einführung von breiteren Straßenbahnzügen geplant um den Menschen-Massen-Transport zu gewährleisten. An der Stelle möchte ich betonen, dass ich schon länger die These vertrete:
„Die Straßenbahn muss in engeren Takten, mit intelligenter Steuerung und Linienführung fahren.“
Das geht bis hin zu autonomen Straßenbahnen, wir werden darüber neu nachdenken müssen.
Ende Intro
Ich möchte meine Gedankensammlung zum Leben nach der Pandemie vorstellen. Die Themen sind nicht nach ihrer Wichtigkeit sortiert. Wie immer erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bin für Anregungen und Kommentare offen. Der nächste Teil folgt in Kürze.
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay